Von Maria Schneider

Wieder einmal fahre ich maskenlos in der Bahn durch das Land – auf dem Weg zu einem der wenigen, verbleibenden Arbeitseinsätze, die der Herrschaft des Coronadämons und seiner Handlanger noch nicht zum Opfer gefallen sind.
Es ist noch nicht einmal 11 Uhr morgens und ich habe schon eine Auseinandersetzung wegen meines freien, gottgegebenen Gesichts hinter mir. Wie in 98 Prozent der Fälle war es eine Dame der höheren Gesellschaft, die sich wieder einmal zur Übergriffigkeit berufen fühlte und mich auf meine fehlende Maske hinwies. Meine Maskenbefreiung quittierte sie mit einem verächtlich-empörten Schnauben nach der Devise: „Wieder so eine, die versucht, sich auf hinterlistige Weise dem verordneten Gleichschritt zum Wohle aller zu entziehen.“ Da ein solches Ausscheren nicht kampflos hingenommen werden kann, versuchte die verhinderte Lageraufseherin gleich mehrfach, mich zum Tragen einer Maske zu zwingen, da ich verpflichtet sei, sie zu schützen. Dass sie ihr Gegacker 1,50 Meter von mir entfernt hinter einer luftdichten FFP2-Maske abließ, genügte ihr selbstverständlich nicht als Schutz.
Erlebnisse dieser Art sind sehr erhellend, denn sie erbringen den Beweis, dass es bei solchen Maßregelungen letztlich eben nicht um Schutz, sondern um die Durchsetzung von nicht zu hinterfragenden Regeln und die Befriedigung der eigenen Machtgelüste geht. Dies hatte ihr Cordhosenmann mit runder Intellektuellenbrille und schütterem, grauem Hippiehaar wohl auch schon aus leidvoller Erfahrung erkannt. Anders läßt sich nämlich nicht erklären, dass er sich während des gesamten Wortgefechts hinter seinem Buch versteckt und keinen einzigen Mucks von sich gegeben hatte.
Und in der Tat war die Maskenaufseherin ein harter Brocken. Erst als ich sie fast anschrie, „Dann setzen Sie sich doch um, wenn Sie sich noch immer ungeschützt fühlen“, herrschte endlich Funkstille. Vermutlich ist das auch der Grundzustand ihrer Ehe. Kurz hatte ich Mitleid mit dem Ehemann, erinnerte mich aber dann an den bewährten Spruch meiner Oma: „Wie man sich bettet, so liegt man.“
Noch unter dem Eindruck dieser Auseinandersetzung steige ich in den nächsten Zug und arbeite mich reichlich genervt mit meinem Koffer durch den engen Gang zum winzigen 1.-Klasse-Abteil des Nahverkehrszugs vor, das über lediglich 9 Sitze verfügt. Hinter mir spüre ich einen gestressten Geschäftsmann. Er ist mir so nah auf die Pelle gerückt, dass ich Mühe habe, die schwere Glastür aufzuziehen, um überhaupt in das Abteil eintreten zu können.
Wie üblich in Unrechtsstaaten mache ich mir sofort zum Selbstschutz ein Bild von der Lage. Auf dem Vierersitz sitzt ein älterer, untersetzter Malocher mit brauner Schmuddelmaske, die halb unter seinem Gesicht hängt. Schräg rechts sitzt ein junger Mann ohne Maske. Er ist vielleicht Ende zwanzig, schlank und schlaksig. Sein braunes Haar ist leicht zerzaust und seine Augen blicken verträumt in die Gegend. Sein gesamtes Wesen strahlt Sanftmut aus und auf seinem Gesicht liegt ein leichtes Lächeln. Irgendwie erinnert er mich an den jungen Alain Delon.
Schnell schlängle ich mich hinter Schmuddelmaske auf den Zweiersitz, damit der drängelnde Geschäftsmann auch hineinkann. Er setzt sich mit seinem schwarzen Aktenkoffer zackig auf den Einersitz auf der anderen Seite des schmalen Ganges von mir und sondiert ebenfalls die Lage. Seltsamerweise scheint er mein freies Gesicht zu übersehen und greift statt dessen sofort den jungen, maskenlosen Mann an, der vor ihm sitzt: „Sie müssen eine Maske tragen!“, tönt es dumpf aus seiner Schnabelmaske.
Der junge Mann erwidert mit einem entzückenden französischen Akzent: „Excuse me?“
„You must wear a mask!“, befiehlt der Geschäftsmann in germanischem Englisch.
Franzose: „I am vaccinated.“
Doch das ficht den Schnabelmann nicht an. Er beugt sich von seinem Sitz aus nach vorne und schnabelt den Franzosen direkt an: „Here in Germany you must wear a mask. It is the law.“
Franzose: “But I am vaccinated.”
Schnabler: “Me too.”
Franzose: “But then you are protected.”
Gerade als der Schnabler Atem holt, um den Franzosen weiter unter Druck zu setzen, rastet der Malocher mit Schmuddelmaske vor mir aus. Er hatte sich zwar bislang ruhig verhalten, aber genauso wie ich kann man in einem solch kleinen Abteil gar nicht anders, als jedes Gespräch mitzuhören:
„Jetzt lassen Sie ihn doch in Ruhe. Es reicht, wenn die Regierung uns gängelt. Das ist doch nur ein Maulkorb und schützt sowieso nicht. Sie benehmen sich wie unter Hitler.“
Ich: „Ihre Maske schützt Sie doch nur, weil Sie daran glauben.“
Der Schnabler setzt an, etwas zu sagen, doch Schmuddelmaske unterbricht ihn schnöde:
„Es reicht jetzt! Es wäre wirklich gut, wenn Sie einfach mal den Mund halten und die Leute in Ruhe lassen. Hier ist 1. Klasse und keine Holzklasse.“
Schnabler: „Wie reden Sie überhaupt mit mir! Ich habe diesen Ton nicht benutzt. Wie kommen Sie dazu, mich mit der Hitlerzeit zu vergleichen?“
Und nun spielten Schmuddelmakse und ich uns regelrecht die Bälle zu.
Ich: „Sie gängeln diesen jungen Mann und lassen ihn nicht in Ruhe. Das ist in der Tat wie unter Hitler. Denn damals gab es viele kleine Hitlers, die andere ständig gemaßregelt haben. Vermutlich merken Sie nicht einmal mehr, wie Sie sich verhalten.“
Erneut will der Schnabler lospicken, doch der wütende Malocher schreit ihn nun richtig an: „Bleiben Sie doch einfach mal sitzen und sagen nichts.“
Ruhe.
Ich stupse Schmuddelmaske von hinten an und zeige ihm ein „Daumen hoch“. Er erwidert mein Zeichen. Zufrieden lehne ich mich zurück und genieße unseren Sieg.
Doch die Geschichte ist noch nicht vorbei. Zu meinem großen Erstaunen sucht nun der Franzose das Gespräch mit dem Schnabler und fragt ihn, ob er denn ewig so mit der Maske leben wolle.
Nachdenklich erwidert der: „Nein.“
Franzose: „Glauben Sie an die Wirksamkeit der Spritze?“
Schnabler: „Nicht ganz“.
Oha!
Franzose: „Ich kann und will einfach nicht mehr so leben. Wir müssen uns mit dem Virus anfreunden.“
Ich beobachte, wie sich das ruhige, respektvolle Gespräch zwischen den beiden entspinnt. Auch in mir kommt etwas in Bewegung. Ich bewundere den jungen Franzosen für seine Standhaftigkeit und Sanftheit. Für seine Fähigkeit, das Gespräch mit einem Menschen zu suchen, der ihn noch kurz zuvor angegriffen und stark unter Druck gesetzt hat.
Doch dann nähert sich die Schaffnerin. Ich bedeute dem Franzosen, dass es jetzt maskenkritisch wird. Er kramt aus seiner Hosentsche eine ziemlich lädierte Maske heraus und setzt sie sich mehr schlecht als recht unter der Nase auf. Die Schaffnerin ist jedoch mehr an seinem Ticket interessiert. Es gilt nur für die 2. Klasse und so verweist sie den jungen Alain Delon sehr höflich und freundlich in das andere Abteil.
Während ich mein Maskenbefreiungsattest hervorkrame, geht er an mir vorüber. Ich lächle ich ihn an und sage, „Au revoir, mon cheri“, und er lächelt zurück.
Die Schaffnerin schaut mein Attest – wie mir scheint, mit voller Absicht – gar nicht richtig an und sagt entschuldigend: „Leider muss ich Sie danach fragen“.
Wenig später erreiche ich meinen Zielbahnhof. Auf meinem Weg nach draußen sehe ich den sanften Franzosen ein letztes Mal. Er sitzt mit seinem schönen, freien Gesicht allein auf einem Zweiersitz. Ich lasse es mir nicht nehmen und sage zum Abschied: „You are very courageous, my dear!“
Wir lächeln uns an und ich mache mich auf zu meiner S-Bahn. Das war schon die zweite Maskengeschichte an diesem Tag und es ist noch nicht mal 12 Uhr. Tatsächlich erlebe ich noch eine dritte Episode – doch diese wird Gegenstand meiner nächsten Maskengeschichte sein.
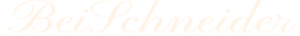
Kommentarfunktion ist geschlossen.