Gewidmet allen Busfahrern, die mir ihre Geschichten erzählt haben
Von Maria Schneider

Krauses letzte Fahrt begann in aller Herrgottsfrüh’ an einem klirrend kalten Wintertag. Er hatte die Frühschicht zugeteilt bekommen, die um 04.30 Uhr begann und sich – wie man sich denken konnte – keiner besonderen Beliebtheit erfreute. Krause war müde – vom Arbeiten, vom Leben und einem ständigen Gefühl, irgendwie festzusitzen – und zwar nicht nur in seiner Fahrerkabine. Und so hatte es ihm gerade noch gefehlt, dass eine 10-köpfige, lärmende Gruppe Afrikaner in seinen Bus einstieg. Krauses Rücken versteifte sich, denn ihm schwante nichts Gutes. Dennoch versuchte er sich, trotz der lauthals auf Arabisch und Afrikanisch geführten Handytelefonate, weiterhin auf das Fahren zu konzentrieren und ließ die gestrige Teamsitzung Revue passieren.
Wieder einmal hatte der Chef, Herr Bange, alle Busfahrer einberufen, um sie auf Linie zu bringen. Zum x-ten Mal hatte er ihnen eingetrichtert, dass man sich bei Afrikanern und Arabern in Toleranz üben und sich jede Art von Beschimpfung gefallen lassen müsse. Auch Hinweise, dass man als Fahrgast ein Ticket zu lösen oder deutsch zu sprechen habe, seien Vertretern dieser Volksgruppen gegenüber tunlichst zu unterlassen. Krause war über diese Anweisung schon längst im Bilde – war doch sein bestens integrierter Kollege Ali lediglich auf Grund seines Namens knapp einer Entlassung entkommen, weil er einen Neuankömmling aufgefordert hatte, Deutsch als Amtssprache zu benutzen. Diese rassistische Unverfrorenheit hatte die deutschen Fahrgäste so empört, dass sie Ali sofort den Vorgesetzten Herrn Bange und die Polizei auf den Hals gehetzt hatten. Schließlich hält doppelt genäht besser.
Doppelt genäht hält besser
Kollege Maier – immer etwas stürmisch, doch letztlich ein nachgiebiger Trottel – wandte ein, ob man denn warten solle, bis man ein Messer im Bauch habe. Bange hatte daraufhin nur müde mit den Achseln gezuckt und war ungerührt mit seinen Instruktionen fortgefahren. Kollege Schulz hatte gebrummt, „Ich sage mal nichts dazu“, und Kollege Kowalski, der sowieso nur solange in Deutschland malochen würde, bis es kein Kindergeld mehr für seine drei Kinder geben würde, hatte nur verächtlich geschnaubt. Alle anderen Kollegen waren stumm geblieben wie tote Fische auf dem Kutter.
Eindringlich schärfte ihnen Bange ein, dass alle Flüchtlinge weiterhin umsonst zu befördern und grundsätzlich mitzunehmen seien. Auch das wußten die Fahrer schon zur Genüge. Doch dann präsentierte Herr Bange jedem Fahrer einen Vertrag zur Unterschrift. Darin stand nochmals schwarz auf weiß, dass jegliche Übergriffe, Beschimpfungen und sonstige Vorfälle mit Flüchtlingen in den Bussen hinzunehmen seien und darüber striktes Stillschweigen zu bewahren sei – neu daran war jedoch die Konventionalstrafe von 20.000,00 Euro bei Nichtbeachtung dieses Maulkorbs.
Angesichts der langen Bandwurmsätze hatten die meisten Busfahrer das Lesen schon nach den ersten Worten aufgegeben. Die Osteuropäer in der Belegschaft hatten es gleich gar nicht versucht. Eines hatten aber alle Fahrer verstanden: Diese Verträge und die hohe Summe von 20.000,00 Euro verhießen nichts Gutes. Daher hatten sie in seltener Einigkeit die Unterschrift verweigert – allen voran die Osteuropäer. Und so hatte Chef Bange diesmal ausnahmsweise trotz alle seiner Überredungskünste und Drohungen auf Granit gebissen. Denn alle auf einmal konnte er nicht entlassen. „Das kommt davon, wenn man jahrelang den Lohn senkt“, hatte Maier – nicht nur Trottel, sondern auch Kriecher vom Dienst – Krause zugeflüstert und schadenfroh gegrinst. Das hatte der Chef Bange nun davon, weil er seit Neuestem nicht einmal mehr die Pausen bezahlte – selbst wenn man 2 Stunden inmitten einer Ödnis auf einem Parkplatz ausharren mußte, bis die nächste Tour begann.
Immer wieder durchhalten
Krause fuhr die nächste Haltestelle an und ließ sich seine persönliche Situation durch den Kopf gehen. Das Geld war einfach zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Lange genug hatten sich seine Frau Helga und er den Kopf darüber zerbrochen, wie sie noch Geld einsparen könnten. Lange genug wohnten sie schon in einer winzigen Wohnung, deren einziger Vorteil die räumliche Nähe zu seiner Arbeit war. Lange genug ertrug er es schon, dass seine Frisur so aussah, als hätte Helga ihm einen Milchtopf über den Kopf gestülpt und seine Haare mit einer stumpfen Schere abgeschnitten – wahrscheinlich, weil sie eben genau dies tat, um das Geld für den Friseur zu sparen.
Immer wieder hatte er sich selbst angespornt, trotz der Lohnsenkungen weiterzumachen, obwohl sich der Job nicht einmal mehr für die vergünstigten Monatsfahrkarten seiner Kinder lohnte. Ach, wäre er doch nur bei seinem früheren Job auf der Baustelle geblieben. Da war die Arbeit hart gewesen, man war der Witterung ausgesetzt – aber man mußte sich wenigstens nicht ohne jeden Anlass ständig beschimpfen lassen.
Plötzlich wurde Krause jäh aus seinen Gedanken gerissen: Hinten im Bus gab es schon wieder Tumult. Drei neu zugestiegene Afrikaner regten sich lautstark darüber auf, dass er die Tür für sie eine Zehntelsekunde zu spät geöffnet hatte. Anlass genug, Krause besonders unflätig zu beschimpfen. Als hätten sie gewittert, dass er heute besonders empfänglich für Provokationen war, fielen Begriffe wie „Hurensohn“, „Nazi“, „Schwein“ etc. Die afrikanischen Südländer bewiesen einmal mehr ihre hervorragenden Deutschkenntnisse. Jeder Fluch, jeder Begriff traf Krause wie ein Messerstich.
Und da wurde Krause mit einem Mal bewusst, dass das Maß voll war. Er beschloss, dass diese Fahrt seine letzte Fahrt sein würde. Monatelang hatte er sich verlachen, beschimpfen, anschreien, beleidigen und bedrohen lassen. Stoisch hatte er wieder und wieder alles hingenommen, hatte das Bremspedal und die Schaltung traktiert, leise vor sich hingeflucht und an ganz besonders schlimmen Tagen in der Pause gegen die Wände des Toilettenhäuschens der Busfahrer getreten. Ungezählt die Zigaretten – sein letzter Luxus – die er vor Wut angesichts der ständigen Demütigungen fast aufgegessen hätte.
Der Tag der Tage
Heute war der Tag der Tage. Der Tag, von dem er immer wusste, dass er irgendwann kommen würde. Der Tag, an dem der letzte Tropfen das Faß zum Überlaufen bringt. Der Tag, an dem Busfahrer Krause einfach nicht mehr konnte.
Als ein weiteres Mal das Wort „Nazi” fiel und ein Afrikaner ihm mit geckerndem Lachen den Stinkefinger zeigte, fixierte Krause ihn etwas genauer im Rückspiegel. Da brate ihm doch einer einen Storch – das war doch der Handymann! Höchstens 19 Jahre alt, immer top gestylt mit knallroten Markenturnschuhen und – am allerwichtigsten – stets mit dem allerneuesten Smartphone und dem größten Wortschatz an deutschen Schmähreden ausgerüstet, der je an Krauses behaarte Ohren gedrungen war.
Das war der berühmte Tropfen. Krause zog mitten auf freier Strecke die Bremse, stoppte den Bus, stemmte sich hoch, richtete seinen Gürtel und marschierte nach hinten. Dort packte er den Handymann, schüttelte ihn durch wie einen Cocktail an der Bar, bohrte seine himmelblauen Augen in die aufgerissenen Augen des Afrikaners und ermahnte ihn eindringlich, die Kraftausdrücke zu lassen. Schlagartig verstummte sämtliches Geschnatter seiner Flüchtlingskumpel.
Oh, welch’ himmlische Ruhe im Bus plötzlich herrschte! Krause löste seinen Griff, der Handymann plumpste wie ein Sack Mehl auf seinen Sitz und verfiel in eine kleine Schockstarre. Ganz die Ruhe selbst schritt Krause, gefühlte 2 Zentimeter größer, wieder nach vorne und setzte seine Fahrt leise vor sich hinpfeifend fort.
Ausscheren aus dem Willkommensgleichschritt
Nur wenige Minuten später zwang eine kleine Flotte an Polizeiwagen den Bus zum Stehen und befragte Krause, was passiert sei. Denn natürlich hatte ein deutscher Untertan die Polizei bereits im vorauseilenden Gehorsam über Krauses Ausscheren aus dem verordneten Gleichschritt informiert, die daraufhin unverzüglich die Videoaufzeichnung des unerhörten Vorkommnisses im Bus gesichert und gesichtet hatte.
Zwar hatte Krause schon erwartet, dass die Polizei recht schnell auftauchen würde – derartige Einsätze haben in Deutschland bekanntlich höchste Dringlichkeit, und auf seine Landsleute ist beim Denunzieren einfach Verlaß. Dass jedoch gleich vier Streifenwagen mit quietschend Reifen angebraust kamen und man sich fast darum riss, ihn zur Rede zu stellen, maßregeln und „belehren“ zu können, das überraschte ihn dann doch.
Obwohl … irgendwie konnte er die Beamten auch verstehen. Denn wie oft kommt ein Polizist heute noch in den Genuß, ohne Gefährdung des eigenen Lebens bei einem aufmüpfigen, 50-jährigen, korpulenten, männlichen, weißen Deutschen – eine Spezies, inzwischen fast rarer als ein Einhorn – endlich wieder einmal so richtig die „Autoritätssau“ rauslassen zu dürfen? Krause, geläutert durch seine eigenen Erfahrungen und für seine an Selbstaufgabe grenzende Gutmütigkeit bekannt, gönnte der Polizei dieses kümmerliche, kurze Machtgefühl von Herzen.
Vermutlich war es auch besagter Gutmütigkeit zuzuschreiben, dass er seine Schicht in Würde beenden durfte, bevor er bei Herrn Bange zum Rapport antreten und sich seine Standpauke anhören musste: Was er sich da erlaubt habe! So etwas ginge ja gar nicht! Wo kämen wir denn da hin! Asylbewerber seien immer mit Respekt und Höflichkeit zu behandeln. IMMER! Denn wer wüßte schon, was sie durchgemacht hätten und unter welch schrecklichen „Traumas“ sie litten. Ja, Herr Bange sagte tatsächlich „Traumas“, denn Sprachen waren noch nie seine Stärke gewesen. Genau deshalb bekleidete er ja diesen Chef-Posten und führte brav sämtliche Befehle von oben aus. Denn gerade einem Herrn Bange war klar, dass für ihn Endstation war, wenn seine Mitarbeiter nicht wie gewünscht spurten.
Und deshalb tat Bange auch diesmal genau das, was von ihm erwartet wurde: Er schloss seine Auslassungen nach geschlagenen 10 Minuten mit der fristlosen Entlassung von Krause ab und bekräftigte sein Verdikt mit einem so resoluten Faustschlag auf dem Tisch, dass er einem Fliegengewichtler alle Ehre gemacht hätte.
Und Krause? Krause schwieg während der gesamten Tirade. Denn was bliebe noch zu sagen, was nicht schon längst gesagt worden wäre? Was soll man noch tun, wenn wahre Größe so selten geworden ist wie Schnee im Sommer? Wenn Menschen sich selbst und andere für Konsum und Status verraten? Was tun, wenn so viele Mitmenschen aus Angst vor Ächtung vor anderen kuschen, obwohl doch so viele darauf warten, dass irgendjemand den ersten Schritt tut, um aus diesem Alptraum zu erwachen?
In solchen Augenblicken erkennt man, dass man auf sich selbst zurückgeworfen ist. Dass man alleine sich und seinem Gewissen verantwortlich ist. Dass jeder seinen Weg gehen muss, um sich, seiner Familie und seinen Freunden in die Augen sehen zu können. Dass manchmal einfach der Worte genug gewechselt sind. Dass einem nichts anderes bleibt, als sich umdrehen und zu gehen.
Und genau das tat Krause. Er nahm seine Papiere, drehte sich um und ging. Ohne Arbeit, ohne Lohn, aber inzwischen vier Zentimeter größer und mit einer Frau, die zu Hause auf ihn wartete und ihn für seinen Mut liebte.
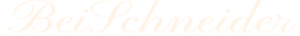
Kommentarfunktion ist geschlossen.