Ich danke Klaus Kunze für die Veröffentlichung des Artikels.
Konservativ empfindet, wer die Welt liebt, wie sie ist. Warum sollte er alles umstürzen? Michel de Montaigne (1533-1592) zählte noch keine vierzig Jahre, da setzte sich der gewesener Richter zur Ruhe. In seinem 16 Schritt durchmessenden Turm zog er sich zu seinen etwa 1000 Büchern zurück: zumeist lateinische Ausgaben antiker Klassiker. Er lebte fortan von seinen Gütern.

Offen gibt sich Montaigne als Konservativer zu erkennen:
Ich verabscheue Neuerungen, welches Gesicht auch immer sie tragen mögen, und ich habe Grund dazu. weil ich äußerst verhängnisvolle Auswirkungen hiervon erleben mußte. Jene, die uns nun schon seit fünfundzwanzig, dreißig Jahren so hart zusetzt, hat zwar nicht alles allein angerichtet, aber man kann mit einigem Recht sagen, daß sie zumindest mittelbar alles erzeugt und hervorgebracht hat – sogar die Untaten und Zerstörungen, die seitdem ohne sie, ja gegen sie verübt werden.“
Montaigne, Buch I, 23, S.66.
In Frankreich war das 16. und in Deutschland das 16. bis 17. Jahrhundert die Epoche der Religionskriege. Die von Montaigne genannten Neuerungen waren die Edikte von Châteaubriant (1551), von Compiègne 1557 und von Écouen 1559. Durch sie wurden Protestanten entrechtet und zuletzt dem Tode überantwortet, was zu den Hugenottenkriegen führte und 1572 in der Bartholomäusnacht Tausende hugenottischer Opfer forderte. Der Katholik Michel de Montaigne hätte lieber alles beim Alten gelassen, hatten die Neuerungen doch zu diesen Exzessen und einer “Zersetzung der Gesellschaftsordnung“ geführt.
Das Frankreich des 16.Jahrhunderts sah neben Hugenottenverfolgungen auch auf Schiffen mitgebrachte Kannibalen aus Südamerika. Montaigne vergleicht 1580,
„es ist noch barbarischer, sich an den Todesqualen eines lebendigen Menschen zu weiden, als ihn tot zu fressen: barbarischer, einen noch alles fühlenden Körper auf der Folterbank auseinanderzureißen, ihn stückchenweise zu rösten, ihn von Hunden und Schweinen zerbeißen und zerfleischen zu lassen (wie wir es nicht nur gelesen haben, sondern in frischer Erinnerung noch vor uns sehen: keineswegs zwischen alten Feinden, sondern zwischen Nachbarn und Mitbürgern, und, was noch schlimmer ist, unter dem Vorwand von Frömmigkeit und Glaubenstreue), als ihn zu braten und sich einzuverleiben, nachdem er sein Leben ausgehaucht hat.“[1]
Michel de Montaigne, Essais, 1580, Buch I, 31, S.113.
In seiner Nachbarschaft massakrierten sich Bekannte und Verwandte teils wechselseitig wegen theologischer Spitzfindigkeiten. Jedem, auch Montaigne, drohten Folter und Scheiterhaufen für jede „Ketzerei“. Es ist höchst lehrreich und für unsere Zeitverhältnisse relevant, wie sich der hochgebildete Montaigne in dieser Lage verhielt. Gut konservativ hielt er eine festgefügte sittliche Ordnung und Institutionen für notwendig, die unberechenbaren Kräfte der menschlichen Natur einzudämmen.[2] Die katholische Kirche war für ihn ein solcher Garant einer möglichen Ordnung, weshalb er äußerlich treu an ihr festhielt. „Er war ein praktischer Konservativer, kein erklärter, kämpferischer, ideologischer“[3], sondern blieb jeder Lehre gegenüber skeptisch.
Zwischen Skylla und Charbydis
Als Jurist und guter Rhetoriker wußte Montaigne immer, seine wahre Meinung durchblicken zu lassen, ohne daß die Inquisition ihn festnageln konnte. In einem und demselben Essai (Buch I, 23) bringt er es fertig, einander widersprechende Behauptungen in einer Weise aufzustellen, daß die eine ihn vor Verfolgung schützt, die andere aber die Kritik enthält. Montaigne beteuert die „unmißverständliche Ermahnung, der Obrigkeit zu gehorchen und die jeweilige Regierungsform nicht anzutasten“, deren „Neuerungen“ er unmittelbar zuvor in Grund und Boden verwünscht hat.
Die Widersprüchlichkeiten lösen sich sofort auf, wenn man das eine als seine tatsächliche Meinung, das andere als rhetorisches Feigenblatt zu seinem Selbstschutz betrachtet. In einem anderen Essai gibt er das offen zu:
„Es ist nämlich nicht so, daß diese Geschichten oder die Zitate mir immer nur zum Beispiel, zur Beglaubigung oder zur Ausschmückung dienten: Ich betrachte sie keineswegs bloß unter dem Blickwinkel des Gebrauchs, den ich davon mache. Oft tragen sie über ihre Beziehung zu meinem Thema hinaus den Keim zu vielschichtigen und gewagteren Überlegungen in sich und lassen sowohl für mich, der ich mich nicht weiter hierüber äußern will, als auch für jene, die sich auf meine Denkweise einzustimmen vermögen, einen feinen Unterton mitschwingen.“
Montaigne, Essais, 1580, Buch I, 40, S.130.
Die gewagteren Überlegungen läßt Montaigne wohlweislich unausgesprochen. Er beläßt es beim Unterton des Unglaubens: “Ich zweifele an mir wie an allem sonst” (II 17 S.314). Diese Argumentationstechnik ist typisch für Epochen, in denen Gesinnungspolizei mit Folterkammer, Scheiterhaufen oder Lagerhaft nur auf ein falsches Wort wartet. Vorsicht ist dabei umso ratsamer, je umfassender eine bekämpfte Herrschaft die Gesellschaft regiert. René Descartes (1596-1650) riet einmal einem Freund: “Ich möchte auf alle Fälle, daß Du Deine neuartigen Gedanken nicht offen vorträgst, sondern Dich äußerlich an die alten Prinzipien hältst. Du sollst Dich damit begnügen, zu den alten neue Argumente hinzuzufügen. Dies kann Dir niemand übelnehmen; und diejenigen, die Deine Argumente verstehen, werden von sich aus darauf schließen können, was Du ihnen klarmachen wolltest.”
Daß sein Leser verstehend mitdenkt und zu Ende denkt, muß ein Schreibender vor allem unter totalitären Herrschaften hoffen. Spätere Generationen erkennen die geistige Handschrift solcher Zeiten daran, daß zwischen Zeilen mehr steht als in ihnen.[4]
Tabubruch
Gottesstaaten wie im Islam und andere Gesinnungsstaaten stellen ihr jeweiliges Allerheiligstes unter Tabu. Ein Witz über Mohammed kann der letzte sein, den sich jemand erlaubt. Auch heute darf man in Deutschland nicht über alles Witze machen. Denken Sie verstehend mit?
Im Abendland waren die Existenz Gottes und die Wahrheit der christlichen Offenbarung sakrosankt, heute ist es ein quasireligiöses Verständnis der Würde eines Abstraktums Mensch an sich. Montaigne wußte genau, wie er seine Kritik verpacken mußte, ohne ein Tabu zu brechen.
Wer sich gezwungenermaßen der Sprache des Gegners bedienen muß, läuft allerdings Gefahr, dessen “Denkinhalte wenigstens zum unumgänglichen Bezugspunkt eines auf soziale Wirksamkeit gerichteten Denkens” zu machen und sich so die Bedingungen des Gesprächs diktieren zu lassen.[5] Montaigne umschiffte diese Klippe meisterhaft. Der Bezugspunkt allen inquisitorischen Denkens war Gott, und zwar in seiner Interpretation durch die katholischen Theologen. Montaigne preist diesen Gott hymnisch und läßt es nicht an Bekenntnissen zu ihm fehlen. Zugleich beteuert er seine Demut vor den zur Auslegung Gottes Wortes berufenen Theologen. Nein, von Theologie habe er keine Ahnung und keinen Ehrgeiz.
Nach diesen stereotypen salvatorischen Klauseln gibt er es der scholastischen Theologie seiner Zeit knüppeldick. Er zieht ihr durch kluge Argumentation buchstäblich die Teppiche unter den Füßen weg. Sie hatte wesentlich auch auf Vernunftschlüssen basiert. Durch syllogistische Schlußfolgerungen und überzeugende Argumentation hatten die mittelalterlichen Scholastiker die Existenz Gottes beweisen wollen. Montaigne hat dafür nur Hohn und Spott übrig und entwaffnet seine Kritiker zugleich mit dem scheinheiligen Argument: Gottes Ratschlüsse seien so unerforschlich, daß man ihn mit menschlicher Vernunft schlechterdings nicht beweisen könne.

Daß hier der Rubikon zu den „gewagteren Überlegungen“ erreicht ist, verstehen wir sofort. In Montaignes Weltbild besitzt Gott keine Funktion. Man könnte ihn wegdenken, ohne daß es sich ändert. Montaigne führt seine Leser von Argument zu Argument bis zu dem Punkt, wo sie vernünftigerweise nur noch schlußfolgern können: Es gibt Gott überhaupt nicht oder ist zumindest irrelevant. Montaigne rettet sich lächelnd ans sichere Ufer mit der Ausrede: Man könne nur feste an ihn glauben, was er, Montaigne, selbstverständlich täte. Ich sehe ihn dabei vor meinem inneren Auge in seinem Turm herzlich lachen und ergötze mich daran, wie genial mein lange verstorbener Juristenkollege zu argumentieren wußte. Man darf bei ihm nie am Vordergründigen kleben, sondern muß verstehen, was er uns hinter seinen Worten eigentlich sagen will.
Seine Argumente sind vielschichtig und hintergründig. Was sie zu sagen vorgeben, entspricht nicht unbedingt ihrer argumentativen Funktion. Um seine unausgesprochenen „Gedanken“ brauche sich „die Öffentlichkeit nicht zu scheren“ (I, 23), gibt er zu.[6]
Gott – ausmanövriert
Zutiefst skeptisch hält Montaigne vielerlei Philosophenansichten, was Gott und eine Seele seien, nebeneinander und verwirft sie allesamt als lächerlich: „Es ist erstaunlich, daß sogar die verbohrtesten Anhänger des Glaubens an die Unsterblichkit der Seele sich unfähig und außerstande sahen, sie, die sie derart einleuchtend und überzeugend fanden, kraft ihres menschlichen Vermögens zu beweisen. Das sind Träume von Wünschenden, nicht von Wissenden, sagten die Alten.“ (II, 12).[7] Das hört sich sehr modern und agnostisch an: Wir wissen nichts über „Seelen“. Vier Absätze weiter reiben wir uns erstaunt die Augen: „Es war in der Tat recht und billig, uns mit der Dankesschuld für die Wahrheit eines so hehren Glaubens allein an Gott und die Wohltat seiner Gnade zu verweisen, die allein aus seiner freigebigen Hand wir die Frucht der Unsterblichkeit empfangen, die im Genuß der ewigen Seligkeit besteht.“
Während Montaigne genüßlich die Grundlagen des Kirchenglaubens unterwühlt, bügelt er jede mögliche theologische Gegenwehr ab: Wir können keine Gewißheit über Gott haben außer durch Glauben. Darum können uns die Theologen weismachen, was sie wollen. Wie man einst mit einem Bannspruch einen Dämon zu vertreiben meinte, katapultiert er „Gott“ ins argumentative Aus: irrelevant, Glaubenssache, darüber wissen wir gar nichts. Montaigne widerspricht keinem einzigen theologischen Dogma. Sie interessieren ihn nicht mehr, weil er einen entscheidenden Schritt von der mittelalterlichen Scholastik in die aufklärerische Neuzeit geht:
Hinwendung zur Natur
Statt sich mit scholastischen Spitzfindigkeiten und Scheinbeweisen über “Gottes Natur” und den “Menschen an sich” aufzuhalten, wendet Montaigne sich konsequent der realen Natur zu, der für uns sinnlich erfahrbaren Welt, der Mannigfaltigkeit der Tiere, der Völker, der Bräuche und Religionen. Diese Hinwendung wies den Weg für die spätere Empirie und für Naturwissenschaften. Jenseits aller Spekulationen über platonische „Dinge an sich“ verglich er die Kulturen der Menschen und fand sie in ihrer Verschiedenheit alle gleich geeignet, durch irgendwelche Gesetze Ruhe und Frieden zu sichern.
Irgendwelche! Montaigne hält alle kulturbedingten Religionen, Sitten, Bräuche und Gesetze für gleichwertig. Damit relativierte er den Alleingeltungsanspruch des Christentums und stufte es in den Rang von „coustume“ zurück, Sitte, Brauch, Herkommen und Mode. Gesetze, Religionen und Bräuche hält Montaigne für situationsbedingt. Das mußte auf jeden Intellektualismus und jeden Normativismus tödlich wirken.[8]

Intellektualismen sind rationalistisch ausgeklügelte Denkgebilde, die von Postulaten ausgehen und von ihnen durch Deduktion immer weitere Schlußfolgerungen ableiten, ohne sich zunächst in der empirischen Realität umzusehen. Normativismus ist jede Dogmatik, die von einem „moralischen“ Postulat ausgeht, also einer Sollensforderung. Montaigne zerstört die Absolutheitsansprüche aller solcher Lehren. Seine relativierende Denkmethode bedeutetete einen grundsätzlichen „Abschied vom Prinzipiellen“, wie er dieser Tage von einem modischen Philosophen wieder aufgegriffen worden ist. Montaignes „Skepsis zersetzt die Idealität der geltenden Normen, festigt aber ihre faktische Geltung.“[9]
Im skeptischen Abschied vom Prinzipiellen liegt Montaignes bleibende Relevanz. Während die Theologen der Inquisition jede Druckschrift auf Ketzereien durchlasen, müssen heute wieder Verlage Bücher „zurückziehen“, die den Glaubenshaß von Fanatikern auf sich gezogen haben. Öffentlich Bedienstete werden entlassen, weil sie angeblich das Grundpostulat unserer Verfassung „relativiert“ haben sollen: Die „Würde“ des Menschen. Damit ist heute nicht mehr nur die zivilisatorische Grundregel gemeint, daß der Staat keinen Menschen entwürdigen darf. Heute gilt bereits als Feind der Menschenwürde, dem der ethnische Fortbestand seines Volkes wichtig ist.
Ein metaphysisch verstandener Glaube an einen abstrakten „Menschen an sich“ und seine „unverlierbare Würde“ wurde zum ideologischen Grundprinzip, aus dem fröhlich deduziert und von einem Einwanderungsrecht nach Deutschland, einer multikulturellen Gesellschaft, einem staatlichen Mindesteinkommen für alle bis zur Anerkennung real existierender 63 sexueller Geschlechter alles abgeleitet werden kann.
Dem Staat kraft positiven, also gesetzten Rechts zu verbieten, Menschen entwürdigend zu behandeln, war eine notwendige Verfassungsentscheidung. Die Menschenwürde aber zu einem „vorstaatlichen“ (!), also metaphysischen Prinzip zu machen, aus dem jeder beliebige ideologische Inhalt deduziert werden kann, hätte Montaigne nur bitter lachen lassen: “Wer immer unseren Glauben an seine Postulate zu gewinnen weiß, ist unser Herr und Gott.“ (II, 12).[10] So haben wir Heutigen auch unsere Herren Gesinnungswächter. Das Gros der Menschen kuscht vor ihnen, wenn es überhaupt darüber nachdenkt. Die Menschen, seufzt Montaigne, folgen „in ihren Meinungen auf Treu und Glauben“ der „vorherrschenden Auffassung, und „man übernimmt sie mit allem Drum und Dran von Argumenten und Beweisen als Wahrheit, als festes und geschloßnes Lehrgebäude, an dem man nicht mehr rüttelt und über das man sich kein Urteil mehr erlaubt.“ (II, 12).[11]
Wie lange drehen wir Zirkusäffchen noch Pirouetten?
Es sei sehr leicht, auf gesetzten „Postulaten Gedankengebäude jedweder Art zu errichten, denn kraft einer solchen, die Regeln festlegenden Vorgabe lassen sich die übrigen Teile widerspruchsfrei zusammenfügen.“ Unser „Zustimmen und Gutheißen gibt ihnen freie Hand, uns bald links-, bald rechtshin zu ziehen, bis wir nach ihrer Pfeife Pirouetten drehn.“ (II 12)[12]
Solange wir heute im vorpolitischen Raum und der politischen Diskussion nicht die Glaubenspostulate unserer ideologischen Zwingherrn außer Acht lassen, werden wir auf dem Weg der völligen Aufgabe unserer nationalen Interessen und unseres Volkes auch nur solche Pirouetten drehen wie früher ein angekettetes Zirkusäffchen eines Leierkastenmannes. Dagegen weiß Montaigne Rat:

„Jede Wissenschaf hat ihre vorgegebenen Prinzipien, die das menschliche Urteil rundum einengen. Falls ihr gegen diese Schranke, diesen Irrtum des Prinzipiellen einmal anrennt, ertönt aus dem Mund der Prinzipienreiter sogleich der Spruch entgegen, mit Leuten, die keine Prinzipien ritten, debattiere man nicht. Dabei kann es für die Menschen gar keine Prinzipien geben, es sei denn, die Gottheit habe sie ihnen offenbart. Alles andre, Anfang, Mitte und Ende, ist Traum und Schaum. Jenen, die mit Postulaten in den Kampf ziehen, muß man deren jeweilige Umkehrung ins Gescht postulieren.“ [13]
Montaigne, Essais, 1580, Buch II, 12, S. 270.
Darum sollen wir, resümiert Montaigne, alle Postulate „samt und sonders auf die Waage legen, vornehmlich die allgemeinen und solche, die uns tyrannisieren.“
Uns nicht von willkürlich gesetzten Prinzipien und Postulaten tyrannisieren lassen – das ist das bleibende Vermächtnis des skeptischen Konservativen Michel de Montaigne.
[1] Michel de Montaigne, Essais, 1580, Hrg. Hans Magnus Enzensberger, Übersetzer Hans Stilett, Frankfurt 1998, Buch I, 31, S.113.
[2] Panajotis Kondylis, Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus, 1981, S.143.
[3] Klaus Jürgen Grundner, Michel de Montaigne, in: Criticón 1981, 160 ff. (161 r.Sp.).
[4] Klaus Kunze, Mut zur Freiheit, 1995, S.212.
[5] Kondylis, Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus, S.236.
[6] Montaigne, I 23, S.65.
[7] Montaigne, Buch II, 12, S.276.
[8] Kondylis, Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus, S.139.
[9] Hugo Friedrich, Montaigne, 2.Aufl. 1967, hier zit. nach Grundner a.a.O. S.163.
[10] Montaigne, Buch II, 12, S.270.
[11][11] Montaigne, Buch II, 12, S.269.
[12] Montaigne, Buch II, 12, S.269 f., 270.
[13] Montaigne, Buch II, 12, S. 270.
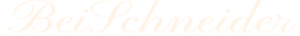
Das Politbüro der Grünen Khmer hat die Tagesschau geentert.
https://journalistenwatch.com/2022/08/31/weg-oer-system/
Nur noch ekelhaft !
„Wir wissen, sie lügen.
Sie wissen, sie lügen.
Sie wissen, dass wir wissen, sie lügen.
Wir wissen, dass sie wissen, dass wir wissen, sie lügen.
Und trotzdem lügen sie weiter.“
US-Admiral Arlaigh Burke
https://www.guidograndt.de/2022/09/01/schwarzbuch-neue-weltordnung-was-die-eliten-planen-und-bereits-umgesetzt-haben/
lieber Patriot,
ich setze noch eins drauf:
„Wir können sie nicht zwingen, die Wahrheit zu sagen.
Wir können sie aber dazu bringen, immer dreister zu lügen.“
https://de.wikiquote.org/wiki/Diskussion:Ulrike_Meinhof
finden sie nicht auch, dass wir – was das betrifft – schon weit gekommen sind?
lieben gruß!
Liebe Elisa,
damit sind wir in der Tat sehr weit gekommen. Genutzt hat es indessen nichts, denn die Schafherde schläft größtenteils weiter und blökt genüsslich vor sich hin.
Schon Napoleon wusste (sinngemäß): Keine Lüge kann grob genug ersonnen werden, als dass die Deutschen sie nicht glauben würden.
Daran hat sich bis heute nichts geändert, ganz im Gegenteil.
lieber Patriot,
leider haben sie auch hier wieder den nagel auf den kopf getroffen.
und was die lügen betrifft: sie müssen nur oft genug – am wirkungsvollsten im staatsfunk/in der qualitätspresse – wiederholt werden, dann geht der inhalt in fleisch und blut über. an diesen orientierungshilfen mangelt es ja bis jetzt noch nicht.
lieben gruß!
OT: Ein paar wichtige Fakten zum – mutmaßlichen – Mord von Lady Diana, mit teils aktuellem Bezug zur Gegenwart
https://www.pravda-tv.com/2022/09/diana-rituelles-opfer-der-neuen-weltordnung-video/
https://www.guidograndt.de/2022/08/31/mordkomplott-lady-diana-mainstream-fake-news-unterschlagene-fakten/
Man sollte immer wissen, mit WEM man es zu tun hat.
Ein echter Denker und Philosoph, ein Weiser.
Was würde Montaigne wohl zu Gender-Gaga, LGBTQI, Klimawandel, Multikulti mit Massenhereinflüchtungs-Tsunami, Russenphobie, “Kernkraft ? Nein Danke!”,
Globalisierung = Turbobrutalokapitalismus, Bürgergeld und “Wir haben Platz” sagen ?
Man kann es sich denken !
Bartholomäusnacht 20./21. Jhdt
https://www.wiedenroth-karikatur.de/KariAblage202208/20220816_USA_Deutschland_Krieg_Trittstufe.jpg
…..!!