
„Sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel, der brüderlichen Gemeinschaft, im BROTBRECHEN und im Gebet“
TEIL 1 – Ursprung und Herkunft
Immer und immer wieder bewegen liturgische Fragen bezüglich der katholischen Messe in der lateinischen Kirche. Immer wieder werden Diskussionen um die heutige, die Nach-Konzils-Messe und die Alte Messe des „Überlieferten Ritus“ und ihre jeweilige Liturgie entfacht.
Daher möchte ich einmal, gerade auch passend zum Fronleichnamsfest, historische Aspekte aufzeigen, die Herkunft, Beginn und erste Entwicklungen der Messliturgie verdeutlichen – steht doch an diesem katholischsten aller katholischen Feiertage die Eucharistie, die Feier des Leibes und Blutes Jesu Christi, im Mittelpunkt und damit auch der, wie der christliche Glaube sagt, für die Menschheit getötete Leib des Gekreuzigten und Auferstandenen, der Leichnam des HERRN der Christenheit:
FRON-LEICHNAM
(Fron aus dem Althochdeutschen Fro, Frono = Herr stammend). Die Italiener erinnern unumwunden an den Kern des Festes, indem sie für dieses schlicht die lateinische Bezeichnung übernahmen: Corpus Domini = Leib des Herrn.
Ursprung und Anfänge der Eucharistie
Für meine Darlegungen dienen mir vor allem Texte des emeritierten Erzbischofs von Paris, Michel Aupetit. Dieser hatte für seine Gläubigen ab der ersten Woche des leidigen „Confinement“ im Jahr 2020, d.h. der damaligen massiven Corona-Einschränkungen der Bürger in Frankreich, die auch die Gottesdienstverbote für Wochen miteinschlossen, mit einer täglichen, profunden Betrachtung der Eucharistie via Internet begonnen, „da wir nun“, wie er schrieb, „die Sonntagsmesse für einige Zeit aussetzen müssen.“ Wir werden sehen, dass die ursprünglichen Messtraditionen nicht weniger kostbar waren, als der von seinen Anhängern so beschworene Ritus der Tridentinischen Messe.
Im Rahmen des gesamten Themenkreises ist es deshalb überaus lohnend, sich einmal einige Gedankenstränge Mgr Aupetits zu den überlieferten Anfängen der Eucharistie anzuschauen. Sie lohnen schon mit Blick auf die von den Traditionalisten so verteufelte „neue“ Messliturgie, die sich mit einigen ihrer Elemente durchaus an den Ursprüngen orientiert. Aus den 31 Folgen umfassenden Abhandlungen Aupetits, die vorwiegend aus geschichtlichen Erläuterungen, aber auch aus meditativen Reflexionen bestehen, stelle ich einige wesentliche Auszüge vor.
Zum Vergleich zog ich die Betrachtungen von Padre Jean-Paul Hernandez, eines renommierten Bibelwissenschaftlers von Rom und Neapel über die Messe heran, der diese 2020/21 in fünf Folgen als Katechese in der Kirche Gesù Nuovo in Neapel hielt. Daraus werden einige Stellen berücksichtigt.
Der erste vorgestellte Gesamtteil fasst die ersten fünf Folgen Michel Aupetits in bedeutenden Punkten zusammen und widmet sich vor allem seinen Darlegungen zur Herkunft der Eucharistie, den Anfängen ihrer „Glaubensgeschichte“ und ihrer Bedeutung für die ersten Christen.
Die Bedeutung der Eucharistie
Erzbischof Aupetit bezeichnete die Eucharistie einmal als das „Rendez-vous der Liebe“ mit Christus.
In seinen Abhandlungen hebt er in bildhafter wie überzeugender Weise die für gläubige Christen wesentliche und beglückende Bedeutung der Eucharistie hervor, versucht jedoch, sie gleichzeitig allen fragenden und interessierten Menschen nahezubringen.
In der Folge betrachtet er in zahlreichen Schritten Herkunft und Geschichte, Entwicklung und Inhalte der Eucharistie als „die Quelle und den Höhepunkt des christlichen Lebens“ (sein Zitat: Vatikanisches Konzil II, Lumen Gentium, Nr. 11). Seine Betrachtungen hoben sich damals eklatant von jenen Corona „infizierten“ Aussagen der deutschen Bischöfe ab, welche die „Kirche“ …als etwas, das… „mehr ist als Eucharistie“, deklarierten (Domradio, 3.Juni 2020) und den Menschen, die während jenen massiven Einschränkungen die Eucharistie vermissten, eine „Eucharistiefixiertheit“ bescheinigten (Domradio, 12.April 2020).
Die Bischöfe deutscher Lande zeigten sich – wie so oft – nicht nur als lächerlich Ergebene der Regieren-DEN, sondern sie höhlten mit ihren Aussagen den (auch von ihnen verkündeten) wesentlichen Kern des christlichen Glaubens aus – abgesehen davon, dass sie auch einen anderen wesentlichen Aspekt von „Kirche“ nicht mehr kannten und diesen gnadenlos vernachlässigten: die Nächstenliebe und die Sorge um den kranken Mitmenschen. Auch darin hob sich der damalige, sich für die Erkrankten und ihre Angehörigen von Anfang an engagierte Pariser Erzbischof von ihnen ab (Poderoso Aupetit, l’arcivescovo medico in prima linea contro il virus, tempi.it, 27.03.2020. Starker Aupetit, der Mediziner-Erzbischof an vorderster Front gegen den Virus).
Die deutschen Bischöfe, die weit davon entfernt waren (und es z.T. noch immer sind), ihren Gläubigen Mut zuzusprechen oder sie gar mit biblisch-spiritueller Nahrung und mit Hoffnung zu stärken, geschweige denn, sie die Freude nicht verlieren zu lassen,
erkannten offenbar nicht, dass gerade die frühen Christen aus der Eucharistie ihre Kraft schöpften, dass sie über die Eucharistie ihre enge Verbindung zu Christus hielten und aus dieser Verbindung heraus für ihre Mitmenschen da waren.
Dass die frühen Christen gerade auch für die Kranken und die „Siechen“ (die Ansteckenden) da waren, die sie als Brüder und Schwestern annahmen, vor deren Erkrankungen sie auch nicht zurückschreckten und sie mit Glaswänden von sich abhielten oder gar alleine ließen:
„Sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der brüderlichen Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet“ (Apg 2,42).
Die Begriffe rund um die Eucharistie und ihre Einsetzung
Messe, Brotbrechen, Eucharistie
Bevor Michel Aupetit die Anfänge der historischen Entwicklung der Eucharistie beleuchtete, betrachtete er mit seinen Lesern zunächst einmal das „Vokabular…“, „mit dem bezeichnet wird, was wir tun, wenn wir dem Herrn folgen.“
Zunächst macht er einen Zeitsprung und führt uns die Bedeutung des jüngsten und noch heute gültigen Begriffs aus, der allerdings erst im 5./6. Jh. aufkam: das Wort
Messe oder Heilige Messe.
Es ist ein Begriff, welcher von jener Zeit an „auf die liturgische Feier, die für die Eucharistie spezifisch wurde, überging.“ Dabei erklärt Aupetit die Herkunft des Wortes aus dem lateinischen missa und mittere sowie dessen Grundbedeutung gesendet werden und senden, d.h. dass die Christen gesendet sind bzw. gesendet werden.
Mit dem Begriff des BROTBRECHENS, auf den Mgr Aupetit sodann eingeht, verweist er auf die älteste, von den frühen Christen verwendete Bezeichnung für das Gedächtnismahl Jesu die „beständig … blieben … im Brechen des Brotes“ (Apg 2,42). Hierbei erläutert er das Wort sowohl als Kennzeichnung für das liturgische Mahl von Jesu Tod und Auferstehung, als auch für ein brüderliches Mahl, das die Liturgie in ihren Anfängen offensichtlich begleitete.
Das Brotbrechen – es war das Wort, mit dem die Ur-Christen das eucharistische Mahl und die daraus erwachsende eucharistische Gemeinschaft bezeichneten. Sie bezogen sich damit eindeutig auf die Worte des Evangeliums, sowohl beim letzten Mahl vor seinem Tod:
„Und er nahm das Brot, dankte und brach es und reichte es ihnen…“ (Lk 22,19), als auch auf jene bei der Begegnung der Jünger mit Jesus, dem Auferstandenen, als sie sich auf dem Weg in das Dorf Emmaus bei Jerusalem befanden:
„Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen“ (Lk 24,30). Es war das Brotbrechen, an dem die Jünger Jesus und seine unverbrüchliche Nähe zu ihnen erkannten.
Aus dem Begriff des Brotbrechens entwickelte sich im Weiteren die liturgische Bezeichnung
Eucharistie, eine Bezeichnung, die heute noch vielfach gebräuchlich ist und die auf das aus dem Griechischen stammende Wort eukharistia bzw. eucharistein zurückgeht, welches Dank sagen bedeutet. In deren Kontext zeigt Erzbischof Aupetit die enge Verbindung zwischen dem Brechen des Brotes und der Danksagung auf, die in der Liturgie unverbrüchlich aufeinander bezogen sind: „Er nahm das Brot, dankte, brach es …“
Mit dem Begriff Eucharistie, der unter den frühen Christen bald schon gleichermaßen Verwendung fand, lenkt Aupetit das Augenmerk insbesondere auf die drei synoptischen Evangelien sowie den Ersten Korintherbrief von Paulus, auf die das Wort zurückzuführen ist. Alle vier Berichte bezeugen, dass Jesus vor dem Segnen und Brechen des Brotes den „Dank“ oder den „Lobpreis“ sprach wie auch das „Dankgebet“ mit dem Segen über dem Wein (Mt 26,26; Mk 14,22; Lk 22,17; 1 Kor11,24).
Segen, Lob und Dank – das Pessach-Mahl
Die Verflechtung von Segen, Lob und Dank stellt Michel Aupetit dann mit Blick auf die Psalmen, von den gläubigen Juden auch als Lobgesänge bezeichnet, eigens heraus und veranschaulicht damit noch einmal betont die jüdische Herkunft des jesuanischen Ritus, der dann in der Mess-Liturgie seine Fortsetzung findet (s. bei Präfation und Sanctus, dem Lobpreis der Engel, Jes. 6,3 in meinem Teil 2). Sowohl in den jüdischen Gottesdiensten, als auch in den häuslichen Liturgien spielt der Psalmengesang zur Verherrlichung Gottes eine wesentliche Rolle. Zu einer bestimmten Gruppe von Lobgesängen, so an Pessach, zählt das Hallel (der Lobpreis Gottes).
Die Verflechtung von Segen, Lob und Dank bilden die spirituellen Grundelemente jeden jüdischen Mahls. Sie bilden somit auch den Grundkanon des Gedächtnismahls Jesu.
Der Ausgangspunkt seines letzten Mahls war laut Evangelienberichten das Pessach-Mahl, jenes Fest- und Gedächtnismahl, welches Jesus mit seinen Freunden in Erinnerung an die Befreiung des Volkes Israel aus der ägyptischen Knechtschaft feierte und an dem das Lamm geschlachtet wurde (das man im Christentum sinnbildlich auf Jesus übertrug wie er selbst auch dem Pessach eine neue Bedeutung verleihen wird, s.u.) – Pater Hernandez hebt dies in seinen Katechesen ganz besonders hervor. Nach der Schlachtung der Tiere im Tempel führten die Juden das Fest stets im häuslichen Festmahl weiter – seit der Zerstörung des Tempels ist Pessach zu einem reinen Hausfest geworden.
Die Feier beginnt – analog zum Schabbat-Abend (s.u.) – mit dem Segen des Hausvaters oder des Ältesten über dem ersten Becher Wein, der dann herumgereicht und von allen geleert wird. Mit den Speisen und dem ersten Hallel folgen der zweite Becher Wein, die Lesung der Exodusgeschichte (s. Buch Exodus, Kap.12, ebenso Dtn 26,5-11) und bei Haupt- und Schluss-Mahl zwei weitere Becher sowie das Große Hallel.
Wein fehlt/e beim Pessach-Mahl nie, wie Jean-Paul Hernandez unterstreicht. Als Geschenk Gottes ist er jedoch bei jedem jüdischen Festmahl von besonderer Bedeutung. In Anlehnung an das Blut des geschlachteten Lammes bei der Befreiung aus Ägypten wählt man an Pessach Rotwein.
Die Grund-Speise jüdischer Festmähler bildet seit jeher das Brot.
Zu Pessach gehören seit der Befreiung aus Äpypten spezielle Brote, als Matzen bekannt. Es sind dies die ungesäuerten Brote, dünne Fladenbrote, die nur mit Mehl und Wasser und ohne Hefe gebacken werden; deshalb wird Pessach auch das Fest der Ungesäuerten Brote genannt – die Nachfolger dieser Brote finden wir im christlichen Ritus ab dem 8. Jahrhundert in den Hostien.
Die Festmähler der Juden standen und stehen stets in enger Beziehung zur Gemeinschaft, gleichsam aber auch zu Gott. Zu Gott als ihrem Schöpfer, dem „Ewigen.“ Dem Ewigen König und dem Gott ihrer Väter. Daher begleiten sie jede Handlung und jede Speise eines festlichen Mahls mit einem Gebet:
dem Dank an Gott, dem Lobpreis Gottes und dem Segen. Beides, die lebendige Mahlgemeinschaft wie auch der damit verbundene tiefe Gottesbezug, wird in den Überlieferungen über Jesus von Nazareth und der Feier seines Gedächtnismahls eindrucksvoll veranschaulicht – ein Glaubensfaktum, das auch Michel Aupetit wiederum seinen Lesern sehr lebendig zu verdeutlichen weiß.
So betont er zunächst den Gemeinschaftsbezug des heiligen Ritus‘, um im Weiteren dessen religiös-spirituellen Charakter, den Bezug zwischen Gott und dem Menschen, hervorzuheben: „Um die (heutige) Messe zu verstehen, müssen wir uns vor Augen halten, dass Jesus während eines Mahls (des traditionellen Pessach-Mahls) das Heilige Abendmahl feierte. Er sprach daher alle Segnungen, die dieses Mahl begleiteten.“
In diesem Zusammenhang verweist Mgr Aupetit nochmals explizit auf die drei synoptischen Evangelien und den Korintherbrief, jedoch nun mit dem Blick auf das Schabbat-Mahl (Mt 26,26; Mk 14,22; Lk 22,17; 1 Kor11,23ff.): „Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis…“ (Mt 26,26-28 u.a.).
Kiddusch – die Heiligung
Der Segen über Brot und Wein. Die Herkunft der Eucharistie aus dem Schabbat-Mahl
Die Nennung von Lobpreis und Dankgebet implizieren die Segnungen, sowohl im jüdischen, als auch im jesuanischen und daraus folgend im christlichen Ritus, auf die der Erzbischof eigens hinweist. Wenn er im Weiteren den gesamten Handlungsstrang eines jüdischen Mahls beleuchtet (s.u.), zeigt er, über Pessach hinausgehend und sich dem Schabbat zuwendend, sehr schön auf, dass jede einzelne Handlung verbunden ist mit dem Dank an Gott: die rituellen Waschungen der Hände – die Aufgaben des Vaters, welche die Segnungen von Wein und Brot beinhalten – die Aufgabe der Mutter, die durch Anzünden und Segnen der Kerzen in der Ankündigung des Schabbat besteht. Letztere stellt Michel Aupetit sinngemäß in den Zusammenhang mit den Lucernarien und der Osterkerze, die in diesen die christlichen Nachfolger der jüdischen Lichtzeremonie finden.
Brotbrechen und Segnung des Weins am Schabbat
Selbst wenn, wie wir sehen, der Ausgangspunkt von Jesu letztem Mahl mit seinen Jüngern das Pessach-Mahl darstellte, das seinem eigenen Ritus, den er in die traditionellen Elemente einbaute, vorausging, können die Parallelen zum Schabbat-Mahl im Weiteren nicht übersehen werden. Die grundlegenden Elemente zu seinem ureigenen Mahl, in dem sich Jesus für seine Freunde und Anhänger verewigte, entnahm er dem Mahl des Schabbat, des Haupttages der jüdischen Woche.
So bilden auch dort Brot (die Challa) und Wein die grundlegenden Speisen.
Dem Brot, Grund- und Hauptnahrungsmittel im Judentum, kommt eine heilige Bedeutung zu. Es wurde seit jeher als besondere Gabe Gottes an den Menschen gesehen, aber auch als Sinnbild für dessen Abhängigkeit von Gottes Gnade.
Der Wein, der, wie wir bereits sahen, bei keinem Festmahl fehlen darf, „entfaltet“ im Judentum eine „facettenreiche Symbolik“ (Jüdisches Museum Berlin); der Weinstock steht für das Volk Israel, der Segen seiner Frucht nimmt folglich an den jüdischen Feiertagen stets eine bedeutende Rolle ein, Gott als Schöpfer des Weinstocks preisend. Der Wein ist aber auch ein Bild für die Freude (s. jüdische Hochzeiten. Auch wenn der Genuss von Alkohol allgemein stark reglementiert ist).
In seinen Ausführungen verdeutlicht Mgr Aupetit daher sehr plastisch die Segensgebete über Wein und Brot am Abend des Schabbat. Er zitiert den Segen der Frau, mit dem diese die Schabbatlichter entzündet: „Gelobt seist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der uns mit seinen Geboten geheiligt und uns angewiesen hat, das heilige Schabbatlicht anzuzünden.“
Er zitiert den Segen des Vaters über dem Becher Wein, bevor dieser an die Anwesenden gereicht wird: „Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du regierst die Welt. Du hast die Frucht des Weinstocks geschaffen“ wie auch den Segen über dem Brot, bevor es der Vater in Stücke bricht und an die Tischgemeinschaft austeilt: „Gelobt seist Du, Ewiger, unser Gott, der Du das Brot aus der Erde hervorgehen lässt.“
Mit den Segnungen und dem Brotbrechen des Schabbat-Mahls führt Michel Aupetit die Leser in eines der Herzstücke der jüdischen Glaubenswelt ein, in das Herzstück, das zu Fundament und eigentlichem Ausgangspunkt der Eucharistie wurde und somit von Anbeginn an zum „Herz des christlichen Lebens“ (eine weitere Bezeichnung, die Aupetit für das Gedächtnismahl Jesu verwendet, ist jene aus der italienischen Kunst des 14./15.Jahrhunderts bekannte Bezeichnung Abendmahl oder Heiliges Abendmahl, die auch Luther verwendete).
In seinen folgenden wie grundlegenden Ausführungen stellt Erzbischof Aupetit das Neue heraus, das Jesus schuf, wenn er im gebrochenen Brot seinen Leib gibt und im gesegneten Wein sein Blut (s.u.).
Gleichzeitig unterstreicht Aupetit aber nochmals, dass der „absolut neue Ritus Jesu … sich … in eine sehr alte jüdische Tradition einfügt.“ Er zeigt einerseits dessen Anknüpfung an das traditionelle, in der Familie gefeierte Mahl des Schabbat-Beginns und seiner rituellen Elemente bildhaft auf, ohne andererseits das Pessach-Mahl, das für Jesus entscheidende Ausgangsmahl in seiner ebenfalls neuen Bedeutung außer Acht zu lassen (s.u.).
Jesu Vergegenwärtigung in Erinnerungsmahl und Hingabe
Mit Blick auf Jesu Gedächtnismahl macht Erzbischof Aupetit jedoch auf einen ganz bestimmten bedeutsamen Aspekt aus der jüdischen Glaubenswelt aufmerksam:
er beschreibt den aussagekräftigen Sinn von Erinnerung, von Gedenken des gläubigen Juden: „Die Verwendung des Begriffs Gedenken, im Hebräischen zikkaron, ist entscheidend. Für den Juden ist das Gedenken keine einfache Erinnerung, nicht etwas, das in Erinnerung bleiben muss. Es ist auch keine offizielle Zeremonie … wie jene am Grab des unbekannten Soldaten …, eine Zeremonie, um ein Ereignis nicht zu vergessen, welches unsere Geschichte kennzeichnet…
Das Gedächtnismahl, das Jesus beschwört, wenn er sagt ‚Tut dies zu meinem Gedächtnis‘
ist eine heilige Handlung. Sie lässt jemanden oder auch etwas vor oder für Gott gegenwärtig werden“, so Aupetit. „Sich an die Werke Gottes zu erinnern, bedeutet, sich in seine Gegenwart zu versetzen. Die Erinnerung an Gott wird daher nie in der Vergangenheit gelebt. Das Handeln des ewigen und lebendigen Gottes ist bis heute Gegenwart.
Gottes Bund mit seinem Volk wird im Gedenken am Leben erhalten.
Wenn Jesus das jüdische Pessach in Erinnerung ruft, bringt er damit gleichzeitig zum Ausdruck, dass der Übergang zur Befreiung fortan durch seinen Leib und sein Blut gelebt wird, durch das Geschenk, das er mit seinem Leben macht. Indem er dieses durch seinen Leib vollbringt, ist er selbst ganz Mensch und jeder Mensch ist davon betroffen.“
Bei der Beschreibung des Schabbat-Mahls hebt Erzbischof Aupetit, wie bereits erwähnt, den Moment besonders hervor, als der Segen über Brot und Wein gesprochen wird und führt ihn verbindend auf Jesus zu, ihn uns dann folgerichtig als den entscheidenden und alles verändernden Moment der Heilsgeschichte vor Augen stellend.
Im Herausarbeiten der Segensworte über Brot und Wein macht Michel Aupetit im fortlaufenden Text das Neue durch Jesus Christus deutlich, mit dem dieser den jüdischen Ritus nicht nur wandelte, sondern in diesem sich selbst für alle Zeiten vergegenwärtigt:
„…Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach’s und sprach: Das ist mein Leib für euch; das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut; das tut, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn sooft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt“ (1 Kor 11,23-26).
Deshalb war es dem Erzbischof, wie er sagt, „für uns … sehr wichtig, … die Gesten Jesu noch einmal zu überdenken, um zu verstehen, worauf die Strukturierung der Messe basiert.“ Aus diesem Grund beschreibt er die Einsetzung der Eucharistie, die Worte und die Gesten Jesu genau.
Mit seinem Verweis auf den entscheidenden Moment, als Jesus über den Schabbat-Segen des Weines hinausgeht und im Wein sich selbst, sein Leben gibt: „Trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird!“ (Mt 26,27; Lk 22,20), faltet Michel Aupetit noch eine weitere Realität vor uns auf: jene, dass Christus mit dieser Handlung noch an eine andere jüdische Glaubensüberlieferung anknüpfe, nämlich an die Torah, das von Gott gegebene Gesetz. In diesem wird das Blut mit dem Leben, der Lebenskraft gleichgesetzt und daher nicht nur als heilig bezeichnet, sondern gleichermaßen als Sühne betrachtet (Lev 17,11–14).
Anhand des Schabbat-Segens des Brotes erläutert Aupetit die gleiche Bedeutungsänderung. Auch in diesem Segen wandelte Jesus den Brot-Segen und setzte nach dem Dank an Gott seine ureigenen Worte an diese Stelle, während er den Jüngern das gebrochene Brot reichte und sich darin selbst, sein Leben, seinen gebrochenen Leib schenkt: „Nehmet und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis“ (Mt 26,26; Lk 22,19. Beim Pessach-Mahl ist allerdings davon auszugehen, dass Jesus kein übliches Brot wie am Schabbat, sondern ungesäuerte Brote verwendete).
Appell eines katholischen Oberhirten
Diese ersten fünf Teile seiner Abhandlungen, denen Erzbischof Aupetit das Gedächtnismahl Jesu, die Eucharistie, widmet, die den zweiten Teil der Messliturgie ausmacht, beschließt er mit den folgenden Gedanken:
er wolle die Christen „die Tiefe der Handlung …, die Christus auch heute noch (in der Eucharistie) vollbringt“, begreifen lassen. Dabei ist es für ihn von großer Bedeutung, ihnen durch seine Betrachtungen zu helfen, „die Quelle“, d.h. Christus „zu finden, um unserem Herrn treuer zu sein und…“ – dann äußert er einen Wunsch, der in seiner Kirche nicht überall auf Begeisterung stieß –
„über die sinnlosen und etwas sterilen liturgischen Streitigkeiten hinauszugehen, welche die Christen heute noch spalten und so viel Schaden anrichten.“
Quellen:
Diocèse de Paris, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, Entretiens sur la messe de Mgr Michel Aupetit, 2020, hier: Teile 1 – 5. Gedanken zur Messe.
Übersetzung wesentlicher Auszüge und Rezeption: Juliana Bauer
1 -5 Liturgia eucaristica, Jean-Paul Hernandez
hier: Comprendere la messa: 4. La liturgia eucaristica (il memoriale):
Eucharistische Liturgie, Die Messe verstehen. Folge 4. Das Gedächtnismahl.
Übersetzung von Auszügen: Juliana Bauer
Verschiedene Literatur zu Judentum, seinen Festen und Liturgien
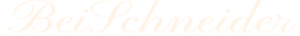
Aus Teil 10 der Aupetit-Betrachtungen:
“Auf dem Konzil von Trient (1562) wurde die Messe als unblutiges Opfer für die Lebenden und für die Toten definiert, in dem das Opfer des Kreuzes vergegenwärtigt wurde. ‘Da sein Tod sein Priestertum nicht beenden sollte, wollte Christus beim Letzten Abendmahl, der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, der Kirche, seiner geliebten Braut, ein sichtbares Opfer hinterlassen, wie es die Natur verlangt, wo das blutige Opfer, das einst am Kreuz vollbracht wurde, vergegenwärtigt dollte und dessen Gedächtnis bis zum Ende der Jahrhunderte erhalten blieb’ (Hebr7:24).
Das Konzil schließt die Möglichkeit aus, dass die Messe in der Volkssprache gefeiert wird, empfiehlt aber deren Erklärung dem Volk (XXII. Sitzung, Kapitel 8). Im Jahr 1570 erschien das von Pius V. refor-mierte römische Messbuch. Es bringt keine großen Änderungen mit sich, da es die Liturgie der Messe aufgreift, wie sie in der römischen Tradition um das 10. und 11. Jahrhundert üblich war. Er übernahm die Praxis, die Messe vor einer kleinen Versammlung durch den Priester zu lesen.”
In Teil 10 beginnt Mgr Aupetit mit der Zeit des Mittelalters.
Heutzutage besteht die Manie, das Christentum zu rejudaisieren. Daher ist es erfreulich, das EB Aupetit neben den jüdischen Wurzeln auch das absolut Neue des Abendmahles betont. Was mir in den Exzerpten abgeht, ist jedoch die Feststellung, daß das Abendmahl die unblutige Vorwegnahme des Kreuzesopfers Christi war. Der Herr feiert hier gewissermaßen das erste Meßopfer. Das ist doch das eigentlich Entscheidende für Katholiken.
Die “tridentinische Messe” wurde nicht wie die “Neue Messe” von Liturgieingenieuren künstlich geschaffen, sondern ist nur eine geringfügige Überarbeitung der vorangegangenen Liturgie. Insbesondere wurden bestimmte “Wucherungen” (unglücklicher Ausdruck) zB bei Sequenz und Tractus bzw. bei den zusätzlichen Orationen beseitigt. Trotzdem ist es schade um so manche dieser “Wucherungen”.
Die Ostkirchen machen den Lateinern den Vorwurf, im 11./12. Jhdt. vom ungesäuerten Brote zu einer Hostie übergegangen zu sein, bei welcher man zweifeln kann, ob hier überhaupt die Materie des Brotes vorliegt. Diese Kritik ist nicht ohne Substanz, umso mehr, als die Säuerung für die göttliche Natur Christi steht.