Philippika über eine Unerträglichkeit von Maria Schneider

Nach einem wunderbaren Abend mit kultivierten Freunden, mit anregenden Gesprächen zur politischen Lage Deutschlands und seiner Filmkunst, schalteten mein Mann und ich die Hypnosescheibe ein, um unter Umgehung des Zwangs-GEZ-Fernsehens eine Abruf-Serie bei einem Streaming-Dienstleister zu sehen. Wider Erwarten blieben wir bei der Eröffnung der Berlinale hängen und waren von diesem entwürdigenden Schauspiel derart gefesselt, dass wir es bis zum bitteren Ende – fast wie bei einer Geisterbahn – durchlitten.
Alles begann mit Meret Becker, die sich im Gegensatz zu ihrem versoffenen, drogensüchtigen Bruder Ben Becker bislang noch einigermaßen gut gehalten hatte. Statt der erwarteten coolen, taffen Frau jedoch stolperte ein weißes Etwas auf die Bühne. Ich rätsele, ehrlich gesagt, bis heute, ob Becker einen zerzausten Schwan, eine gefallene Putte oder einen Staubwedel darstellen wollte. Auf den zweiten Blick meinte ich sogar, in dem seltsamen Fetzen ein mißglücktes Baiser zu erkennen.
Seltsame Gewänder und Fremdscham
Beckers Beine wurden zudem unvorteilhaft in weißen, blickdichten Strümpfen zur Schau gestellt. Dazu trug sie weiße Pumps. Ihr Gesicht war wie eine Porzellanpuppe geschminkt und machte das „Gesamtkunstwerk“ seltsamerweise noch gruseliger. Die Frisur sah aus, als sie kurz vor dem Auftritt unter Strom gesetzt worden. Möglicherweise fungierten die vereinzelt abstehenden Haarstrünke auch als Antennen, um klare Sprechanweisungen zu erhalten; ein Unterfangen, das jedenfalls kläglich mißlang – war doch kaum etwas zu verstehen von den zusammenhangslosen Sprachhappen, die Meret Becker in einem eigentümlichen, mädchenhaftem Singsang auf deutsch, englisch und berlinerisch von sich gab. Der Verdacht drängte sich auf, dass sie unter Drogen stand – vielleicht, weil sie es sonst nicht überstanden hätte, in einem solchen Aufzug die Bühne zu betreten und dort von „Vielfalt“ und sonstigen abgenudelten grünen Kampfbegriffen zu schwadronieren? Das beschnabelte Publikum jedenfalls verfolgte das entwürdigende Schauspiel mit vor Fremdscham und Atemnot aufgerissenen Augen in Agonie und Abstand, bis der sterbende Schwan endlich von der Bühne flatterte. Unnötig zu erwähnen: Es gab keinen Applaus.
Sodann betraten die Leiter der Festspiele, Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek, die Bühne (übrigens war letztere neben Marie Bäumer und Tsitsi Dangarembga die einzige Frau, der bei der Wahl ihrer Garderobe Geschmack und Stil zu bescheinigen waren). Frau Rissenbeek erging sich in minutenlangen Lobhudeleien und katzbuckelte regelrecht vor den mopsigen Sklavenhalterinnen Claudia Roth und Franziska Giffey, die auch im Publikum saßen. Mit ihnen hätte man – in „langen Gesprächen” – dieses Festival samt Hygienekonzept entwickelt und erst möglich gemacht; in der Psychologie spricht man hier übrigens von „Stockholm-Syndrom“: Die Geisel solidarisiert sich mit den Entführer und dankt ihm schließlich für jede Gefälligkeit (und sei sie auch noch so klein), die willkürlich gewährt wird.
Entwürdigende Lobhudeleien
Neben Marie Bäumers Vortrag über „Kino als Leidenschaft” war Carlo Chatrian der einzige authentische Lichtblick unter den Rednern auf der Bühne. Er erdreistete sich sogar – selbstverständlich mit Kaffeefilter im Gesicht –, seine maskenlose Kollegin Mariette Rissenbeek spontan zu umarmen, um seine Freude am Festival und an menschlicher Nähe zu demonstrieren. Leider blieb es bei diesem einmaligen Ausscheren aus dem Zwangskorsett der Hygienemaßnahmen und Politischer Korrektheit; Fantasien, dass Berufsrebellinnen wie Meret Becker oder die Jurymitglieder etwa auf die Existenzvernichtung und Suizide von Künstlern im Verlauf der letzten beiden Corona-Terrorjahre erinnern würden, erfüllten sich natürlich nicht.
Mir kamen in diesem Zusammenhang beispielsweise historische Augenblicke wie die Oskarverleihung 1973 in den Sinn, als die indianische Aktivistin Sacheen Littlefeather in Apachentracht erschien und Marlon Brando vertrat. Sie lehnte in seinem Namen die Annahme des Oskars aus Protest gegen die Behandlung der Indianer in der amerikanischen Filmindustrie ab; damals ein wahrhaft mutiger Schritt, der nicht mit Posten in Staatskanzleien belohnt wurde.
Ich frage mich, was Julia Neigel wohl zu diesem Panoptikum des Grauens sagen würde: Sie alleine hat Kenntnis von zwölf Künstlern, die Suizid begangen haben – und äußerte sich wie folgt: „Es sind sicher noch viele mehr. Menschen, die sich aus purer Verzweiflung das Leben genommen haben, weil sie wirtschaftlich vor dem Aus standen. Ich habe dargelegt, was es für uns Kulturschaffende bedeutet, praktisch einem Berufsverbot ausgesetzt zu sein, wenn es auf der anderen Seite aber keine Entschädigung gibt. Einige Verantwortliche, die jeden Monat eine üppige Diät erhalten, können sich scheinbar nicht vorstellen, wie Menschen ohne Einnahmen ein Dreiviertel Jahr überleben sollen.”
Gnadenlose Gleichschaltung und eine unfähige Moderatorin
Auf den Berliner Filmfestspielen war offensichtlich die Erfüllung der Vielfaltsanforderungen wichtiger. Anders war die Verpflichtung der gänzlich unfähigen äthiopischen Moderatorin Hadnet Tesfai wohl nicht zu erklären, die im Alter von drei Jahren mit ihren Eltern ins Schlaraffenland Deutschland einreiste. Ihr schlammgrünes Strickkleid mit traurigem Dekolleté wirkte wie eine Leihgabe der amtierenden Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Zudem hatte wohl jemand versäumt, Frau Tesfai das Konzept einer Simultanverdolmetschung zu erläutern – denn sie versuchte sich wiederholt in der unbeholfenen englischen Übersetzung ihrer eigenen deutschen Beiträge.
Als Kotau an den Zeitgeist spielte sie beim Interview mit dem „Jury President“ M. Night Shyamalan auf den 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten an (den bösen Trump) – mit der verkrampften Pointe, seitdem könne es nun schwierig sein, überhaupt Präsident von irgendetwas zu sein, vor allem für Shyamalam als Amerikaner. Frau Tesfais respektlose Bemerkung mündete in folgende Frage, in der sie Shyamalan die Antwort in den Mund legte: „Was hat Sie dazu bewogen zu sagen: ‚Gut, ich mache das jetzt. Ich werde die Ehre für dieses Amt wieder zurückholen?”. Als Profi ging Night Shyamalan weder auf die Beleidigung des Ex-US-Präsidenten noch auf die „Zurückholung der Ehre” eines abstrakten Präsidententitels ein, der – so Tesfais Subtext – durch Trump „besudelt” worden sei. Dass Hadnet Tesfai wie selbstverständlich davon ausging, dass Shyamalan „gegen Trump” sein müsse, ist zudem ein klassischer Fall linksgrüner Übergriffigkeit und Vereinnahmung, wie sie den ganzen Abend über zu beobachten war.
Claudia Roth auf dem Höhepunkt ihrer „Karriere“
Kommen wir nun zu Claudia Roth, die als Kulturstaatsministerin mit großem Tamtam wie ein Weltstar angekündigt wurde. Roth verfügt als Qualifikation für ihren hochdotierten Posten bekanntlich über ein abgebrochenes Studium der Theaterwissenschaften und kann eine verkrachte Karriere als Managerin für Ton Steine Scherben vorweisen. Ein Foto von ihr mit Ton Steine Scherben und dem Hund der Band ebnete ihr einst in einem Bewerbungsschreiben den Weg in die Politik: 1985 wurde sie Pressesprecherin der Grünen in Bonn. So begann ihre beispiellose politische Karriere.
Die Eröffnung der Berlinale mag durchaus als Höhepunkt dieser Karriere angesehen werden, und so inszenierte sie sich auch: Frau Roth betrat in weißem Pilzkopf und schwarzem Paillettenkleid die Bühne. Sie sprach frei und sagte auswendig alle Namen der Pfleger auf, die für ihre Verdienste zur Eröffnung eingeladen worden waren. Tatsächlich entpuppte sie sich als eine der besten Rednerinnen dieses Abends und schaffte es sogar, zumindest einen Teil des unwilligen Publikums zu stehenden Ovationen für die Pfleger zu bewegen. Wäre nun Frau Roth nicht Frau Roth und wäre sie – neben zahlreichen anderen Vergehen – nicht mitverantwortlich für Corona-Sonderzahlungen an die Grünen, wäre sie zudem nicht dermaßen egoistisch, nicht so kaltherzig gegenüber den Opfern von Migrantengewalt und so empathielos gegenüber den Künstlern, die unter den unmenschlichen Maßnahmen leiden: Fast hätte ich ihr ein bißchen Lob für ihre frei gehaltene Rede gegönnt. Da Frau Roth aber eben Frau Roth ist, sind meine Anklagen und Ressentiments gegen sie zahlreicher als die Pailletten auf ihrem Kleid und wiegen eine zufällige Ausnahme nicht auf.
Franziska Giffey, gelernte DDRlerin
Die zweite Sklavenhalterin, dank deren gönnerhafter Großzügigkeit die Berlinale genehmigt worden war, erschien in einem lila Albtraum, der mich an die Schondeckchen auf den Sessellehnen bei meiner Oma erinnerte. Die gelernte DDRlerin Giffey hatte ihre Dissertation bekanntlich so stark plagiiert, dass ihr 2021 der Doktortitel aberkannt wurde; sie musste daraufhin zwar ihr Amt als Familienministerin niederlegen, wurde aber – zur Belohnung fürs Verhöhnen und Austricksen aller Ehrlichen und Fleißigen – Regierende Bürgermeisterin von Berlin. Wie ihre Genossin Ursula von der Leyen in Brüssel versucht sie, mit ihren toupierten Haaren mangelnde geistige durch künstliche körperliche Größe zu kompensieren. Wollen wir an dieser Stelle wirklich auf ihre betuliche, mit zartem, mädchenhaftem Unschuldsstimmchen zur Tarnung ihrer brutalen kommunistischen Ideologie gehaltene Rede eingehen? Nein, wollen wir nicht.
Kommen wir deshalb abschließend zu den Mitgliedern der Jury. Jedes Mitglied wurde in einem Kurzvideo vorgestellt und hatte anscheinend die Anweisung erhalten, möglichst „coole” Körperbewegungen zu vollziehen – die jedoch den gegenteiligen Effekt erzielten. Die männlichen Mitglieder – insbesondere Saïd Ben Saïd – bewahrten weitestgehend ihre Würde und machten das Affentheater nicht mit. Das einzige „deutsche“ Mitglied der Jury war Anne Zohra Berrached. Die Tochter eines Algeriers übererfüllte die Vorgabe der vielen Verrenkungen, und sprach statt in ihrer „Muttersprache“ in schlechtem Englisch. Warum? Darf eine Vertreterin des Gastlandes nicht einmal mehr ihre eigene Sprache sprechen? Über ihren braunen Anzug mit überlangen Ärmeln, der wie ein Sack an ihr hing, verlieren wir lieber keine weiteren Worte.
Ein Trauerspiel für Deutschland
Jedes Jurymitglied sollte zudem ein Bild von zu Hause zeigen. Wie nicht anders zu erwarten, wies die Afrikanerin Tsitsi Dangarembga auf die prekäre Situation in Simbabwe hin und zeigte ein Foto mit Gitterstäben. Das unausgesprochene Motto dahinter: Der Weiße darf sich nie entspannen – schon gar nicht auf einem Festival. Er muss stets an seine Verantwortung und Schuld erinnert werden! Was Tsitsi Dangarembga jedoch zugute gehalten werden muss, ist der Umstand, dass sie mit ihrem deutschen Mann und ihren Kindern in Simbabwe lebt und sich immerhin vor Ort für ihr Land einsetzt. Auch ihr Auftreten und ihre Robe – soweit ich dies beurteilen kann, gestaltet mit Elementen ihrer afrikanischen Tracht – zeugten von Würde und Selbstrespekt; etwas, das die deutschen Frauen auf der Bühne nahezu ausnahmslos vermissen ließen.
Kurzum: Die Eröffnung der Berlinale 2022 war ein Trauerspiel für Deutschland. Ein Offenbarungseid für Freiheit, Kreativität und Spontaneität. Eine Groteske, in der die Sklaven so tun, als seien sie frei, und pandemische Sklavenhalter sich als wohltätige Herrscher gebaren. Ein Rückschritt in dunkle Zeiten und ein Armutszeugnis für die Chancen, die Frauen als neue Machthaber hätten nutzen können. Stattdessen dominierten Repression, Kontrolle und Verlogenheit. Eine scheinbar schöne, wunderbare Sahnetorte mit herrlichen Verzierungen, garniert mit etwas Fingerhutextrakt. Es bleibt zu hoffen, dass sie – lieber früher als später – in sich zusammensackt.
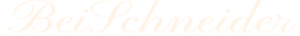
Kommentarfunktion ist geschlossen.